Wir alle haben schon einmal das Wörtchen „dann“ geschrieben und uns nicht viele Gedanken darum gemacht. Warum auch? Dann meint doch einfach nur, dass eben etwas „danach“ geschieht. Es drückt eine „zeitliche, räumliche oder rangmäßige Folge“ (Zitat Internet) aus – etwas folgt auf das, was zuvor beschrieben wurde.
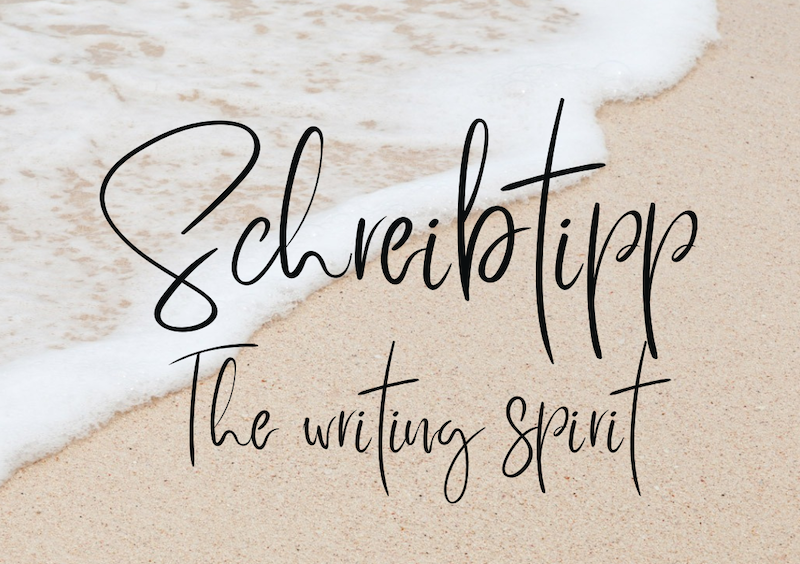
Was ist das Problem mit „dann“?
Ich schlage beim Lektorat manchmal vor, ein „dann“ zu streichen. Einfach, weil es überflüssig ist. Der Satz funktioniert ohne das „dann“ genauso.
Viel öfter aber schlage ich vor, noch mal über ein „dann“ nachzudenken. Das passiert an Stellen im Text, an denen es ein Problem mit dem Sprachfluss gibt – es hakt, es ruckelt, man wird beim Lesen irritiert und fängt an, aus der Geschichte auszusteigen. Das „dann“ zeigt mir als Lektorin an solchen Stellen, dass die Autorin selbst beim Schreiben gemerkt hat: Es läuft nicht rund. Ich brauche etwas, das den Satzfluss macht. Und ein „dann“ erzwingt den Satzfluss.
„Ja“, sagt das Dann, „der Satz folgt wirklich auf den vorherigen.“
Aber eigentlich sollte die Abfolge der Sätze organisch und völlig selbstverständlich ablaufen. Wir sollten kein „dann“ brauchen, das uns erklärt, dass der eine Satz auf den vorherigen folgt.
Auf der Ebene von Sprachgefühl ist ein Text dann gut, wenn ein Satz sich natürlich aus dem davorstehenden ergibt. Kontext, Wortwahl, Wortstellung, Rhythmus – das alles schafft dieses (Sprach-)Gefühl, das uns sagt: Das ist der richtige nächste Satz.
Viel schöner formuliert das der Autor George Saunders in seinem Buch übers Schreiben, Bei Regen in einem Teich schwimmen:
Eine Erzählung ist eine zeitlich lineare Erscheinung. Sie schreitet voran und bezaubert uns (oder nicht), eine Zeile nach der anderen. Wir müssen in eine Erzählung hineingezogen werden, damit sie etwas mit uns machen kann.
Dieser Gedanke hat mich über die Jahre immer wieder getröstet. Ich brauche keine große Literaturtheorie, um Literatur zu schreiben. Ich muss mich nur um eines kümmern: Bekommt ein vernünftiger Mensch beim Lesen der vierten Zeile einen Impuls, der stark genug ist, ihn in die fünfte zu schicken? [S. 23]
Wenn dieser Impuls fehlt, von dem George Saunders spricht, dann setzen wir gerne das Wörtchen „dann“ ein. Wir zwingen quasi die Leserinnen, in die fünfte Zeile zu gehen, obwohl die vierte (noch) nicht so stark ist, dass man weiterlesen will.
Das Dann als Hinweis auf fehlenden Textfluss
Das „dann“ ist deshalb oft ein Hinweis, dass der Satz davor noch nicht gut formuliert ist. Dass du beim Schreiben etwas vermisst hast, das du mit dem „dann“ auffangen wolltest. Aber „dann“ ist nur eine Notlösung, und keine schöne.
Manchmal brauchen wir „dann“ – es gibt Sätze und Formulierungen, wo es einfach nicht anders geht.
Aber meistens brauchen wir „dann“ nicht. Der Text wird stärker, wenn wir die Stelle umformulieren, damit sie leichter fließt und wir locker und geschmeidig auf das „dann“ verzichten können.